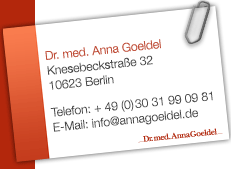Prävention
Warum Prävention als vorsorgende Familienmedizin?
Wer Zukunft gestaltet, muss präventiv denken!
Mit der Prävention als gesundheitsfördernde und krankheitsvermeidende Maßnahme tut sich die Gesellschaft allerdings schwer, während die Behandlung von Krankheiten scheinbar wie selbstverständlich von der Solidargemeinschaft getragen wird – mit hundertfachen Milliardenverlusten.
Präventive Maßnahmen im Gesundheitswesen sind bislang so wenig erfolgreich wie diejenigen beim Klimaschutz. Zwischen Misserfolg und Erfolg steht der Mensch mit seinen "lieb gewonnenen" Gewohnheiten und hochgezüchteten Erwartungen, mit Versorgungsansprüchen, die von einer Generation zur nächsten kritiklos "vererbt" werden.
Nur die Industrie hat unter den Bedingungen eines freien Wettbewerbs schon in den 50-iger Jahren unter präventiven Gesichtspunkten eine regelmäßige Wartung der Wirtschaftsgüter und Qualitätssicherung eingeführt und damit die Investitionskosten auf die Hälfte reduzieren können.
Dabei wissen auch die Akteure im Gesundheitswesen, dass es nicht nur effizienter, sondern oft auch wesentlich effektiver ist, Gesundheit vorbeugend zu schützen, als sie wiederherzustellen. Einige umschriebene Maßnahmen der Prophylaxe haben sich auch als erfolgreich erwiesen, so zum Beispiel die Impfung gegen die Kinderlähmung oder die Pocken. Andere Maßnahmen sind kaum durchzusetzen. So war beispielsweise die Reduzierung des Tabak Rauchens mäßig effektiv, obwohl das Rauchen für etwa 25 % aller Krebsfälle verantwortlich zu machen ist. Auch der Überernährung, der mangelnden Bewegung, Alkoholmissbrauch, einer emotionalen Verwahrlosung, der seelischen und körperlichen Gewalt als Nährboden für spätere v.a. psychosomatische Erkrankungen ist schwer beizukommen. Hier handelt es sich eben um komplexe, aufgrund der Erfahrung in der Familie verinnerlichte individuelle oft unbewusste Verhaltens- und Motivationsprogramme, die bereits in der Kindheit über Assimilation, Imitation oder Identifikation mit dem Verhalten und den Grundüberzeugungen der Eltern begründet werden, deren Annahmen wiederum von der vorhergehenden Generation übernommen wurden.
Vor diesem Hintergrund haben wir das Konzept einer psychosomatischen frühgenetischen Familienvorsorge als Risiko- und Schutzberatung entwickelt.
Es berücksichtigt die zum Zeitpunkt der frühen Familienbildung, also von der Schwangerschaft bis zum 6. Lebensjahr des Kindes, stärker als in anderen Lebensphasen ausgebildete Verantwortlichkeit der Eltern gegenüber der "Familie" bzw. deren Mitglieder und greift in frühen Bindungs- und Identifikationsvorgängen innerhalb der Eltern-Kind-Beziehung auf die Offenheit und Bereitschaft der Eltern für Beratung, Steuerung und Verhaltensänderung zurück. Dass hier nur ein schmales Zeitfenster zur Verfügung steht, zeigt sich darin, dass nur noch zwei von drei Kindern in Deutschland zu den Vorsorgeuntersuchungen ab zwei Jahren gehen, die Compliance also gering ist. Gerade hier bietet die psychosomatische Prävention gegenüber allen anderen wohlgemeinten präventiven Initiativen, den Vorteil, dass die oft unbewussten Widerstände, pathogenen Bindungen oder manifesten Fehlhaltungen oder Fehlverhalten in der Beratungssituation durch den geschulten Blick des Facharztes für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie nicht verborgen bleiben und in die Beratung integriert werden können. Es sind vor allem sozial schwache oder wenig gebildete Eltern und Immigrantenfamilien, die es versäumen nach Aussage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, ihre Kinder zur «U7» bis «U9» zum Kinderarzt zu bringen. Sie bilden auch den Teil der Bevölkerung ab, der besonders intensiv an der Kostensteigerung im Gesundheitswesen beteiligt ist und der mit der psychosomatischen Prävention vorrangig angesprochen wird.
Um die Gesundheit der Bevölkerung präventiv zu fördern, müssen also neben den Kindern auch die Eltern mit den jeweils eigenen Verhaltensmodellen und negativen Erfahrungen im Mittelpunkt der Prävention stehen. Das biopsychosoziale Verständnis muss also um den familialen (auch genealogischen) erweitert werden, um die Komplexität der Entstehung eines krankheitsverursachenden und selbstschädigenden Verhaltens zu durchdringen . Diese Komplexität wird in der Beratung in gezielter und reduktiver Weise in Form von Vermeidungsrichtlinien und Gesundheitszielen in dirigierenden Empfehlungen und Anreizen den Familienmitgliedern vermittelt.
Reine Information in Form von Ankündigung von Aktivitäten z.B. benachbarter Sportvereine hilft hier nicht viel und erreicht nur diejenigen, die ohnehin der Vorbeugung aufgeschlossen sind. Die Politik unterschätzt in ihrem bisherigen Präventionskonzept die starke Bindung innerhalb eines Familiengefüges, den schwer veränderbaren, gesundheitsschädigenden Verhaltenskodex der Familie und die Überforderung einzelner Familienmitglieder diesen aufzuheben.
Ärztlicher Präventionspartner ist hier der Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, der mit seiner organmedizinischen und psychodynamisch-verhaltensmedizinischen Qualifikation das komplexe biopsychosoziale pathogene Geschehen im Vorfeld einer späteren möglichen Erkrankung erkennt und noch vor deren Ausbruch als Symptom steuernd eingreifen kann. Da die Beratung unter mindestens sechs Augen stattfindet, sind die Ehepartner gleichzeitig Beratene, Beratende und Zeugen, die Beratung verbindender und verbindlicher.
Dabei fällt der besonderen Kompetenz dieses Facharztes insbesondere zur vertrauensbildenden Gesprächsführung eine entscheidende Rolle zu.
In der Reihe der wichtigsten gesundheitlichen Risikofaktoren, wie z.B. Alkoholmissbrauch, Tabakkonsum, psychosomatische Prämorbidität, mangelnde psychosoziale Kompetenz, Gewalt und sexueller Missbrauch, genetische und psychogenetische Belastungen, traumatische Ereignisse, wie Scheidung oder Tod, Bewegungsarmut möchte ich die Fehl- bzw. Überernährung/ Adipositas zunächst aufgreifen.
Jedes 4. eingeschulte Kind ist adipös und 80% der adipösen Jugendlichen werden auch zu adipösen Erwachsenen. Weltweit ist von einer Adipositas-Epidemie die Rede. Chronische Erkrankungen und Spätfolgen wie z.B. Diabetes, Herzerkrankungen, Gelenkschäden sind die Folge.
«Die junge Generation wird die erste sein, die vor ihren Eltern stirbt», hatte MdB Frau Künast im Bundestag eine britische Studie zitiert. Bei ungebremstem Trend werde in 40 Jahren jeder zweite Erwachsene unter Fettleibigkeit leiden und ergänzt:
«Übergewicht ist heute eine wesentliche Ursache für viele gravierende Erkrankungen von Kindern und Jugendlichen.» Schon heute würden mehr als 70 Milliarden Euro im Jahr für die Folgen solcher Krankheiten aufgewendet, an denen falsche Ernährung zumindest mitschuldig sei. 2012 werden in Deutschland rund 12 Millionen Diabetiker leben.
Momentan sind die Kosten ernährungsbedingter und ernährungsabhängiger Krankheiten einer der wichtigsten Kostenfaktoren im Gesundheitswesen.
Hierzu Prof. Weiner, Frankfurt: "Das Mortalitätsrisiko bei diesen Patienten steigt im Durchschnitt auf das zwei- bis dreifache der Normalbevölkerung. Die Lebenserwartung vermindert sich dadurch für übergewichtige Männer um bis zu acht Jahre, für übergewichtige Frauen um bis zu sechs Jahre.
Dieser Bereich stellt eine klassische Aufgabe für die Präventivmedizin dar, denn eine nachhaltige Änderung des Essverhaltens bedeutet in der Regel eine Änderung des Lebensstils der gesamten Familie.
Die Versorgungsforschung zeigt: Kinder übergewichtiger Eltern haben ein signifikant erhöhtes Risiko, ebenfalls eine Übergewichtigkeit zu entwickeln. Sind beide Elternteile übergewichtig, so findet sich in bis zu 75% eine Übergewichtigkeit bei den Kindern, ist nur ein Elternteil betroffen, so liegt das Risiko bei bis zu 45% (Risiko bei schlanken Eltern je nach Studie bis zu 10%). Diese familiäre Häufung spricht einerseits für das erwähnte Vorliegen genetischer Faktoren, welche die Entwicklung einer Übergewichtigkeit begünstigen können. Andererseits ist das Verhaltensmuster (Essverhalten, Ausmaß an körperlicher Aktivität) und die Nahrungsmittelzusammensetzung innerhalb einer Familie sehr ähnlich, was die Wichtigkeit von Lernprozessen in der Entstehung der Übergewichtigkeit unterstreicht.
Für Tabak- und Alkoholmissbrauch lassen sich ähnlich gravierende und bedrohliche Aussagen treffen:
In Deutschland sterben pro Jahr etwa 110.000 Menschen an den Folgen von Tabakgenuss, etwa 70.000 an den Folgen von Alkoholmissbrauch. Der volkswirtschaftliche Schaden liegt durch den Tabak bei etwa 17,5 Mrd Euro, der durch alkoholbezogene Morbidität und Mortalität bei etwa 70 Mrd Euro. Die Zahl der alkoholabhängigen Menschen in Deutschland wird auf bis zu 2,5 Millionen Personen geschätzt. Es ist aber auch davon auszugehen, dass ca. 2 Millionen Kinder und Jugendliche bis zu 18 Jahren in Familien mit wenigstens einem alkoholabhängigen Elternteil leben. Die Zahl der erwachsenen Kinder aus Suchtfamilien ist auf bis zu 6 Millionen Männer und Frauen zu veranschlagen.
Das Risiko für ein Kind aus einer suchtbelasteten Familie, selbst suchtkrank zu werden, ist im Vergleich zu Kindern aus unbelasteten Familien ca. um den Faktor 6 bis 8 erhöht. Nach der oft zitierten Arbeit von COTTON (1979), deren Inhalte auch heute noch Gültigkeit haben dürften, werden 30% - 50% von Kindern aus Suchtfamilien selbst im Laufe ihres Lebens suchtkrank (Lebenszeitprävalenz), wobei der Eintritt der Störung im Durchschnitt früher als bei Alkoholabhängigen passiert, die aus einer nicht suchtbelasteten Familie stammen. Erwachsene Kinder aus Suchtfamilien sind außerdem mit vielen anderen medizinischen Diagnosen übermäßig häufig belastet (z.B. im Bereich affektiver Störungen, Schizophrenien, psychosomatischer Störungen, Persönlichkeitsstörungen, insbesondere Borderlinestörungen und antisoziale Persönlichkeitsstörungen).
Der Risikofaktor "Mangelhafte Bewegungserfahrungen" im Kindesalter bedingt z.B. Auffälligkeiten in seelischen Persönlichkeitsbereichen. An ihr leidet die Entwicklung des Selbstkonzepts und des Sozialverhaltens, sowie das Lern- und Leistungsverhalten.
Die Auswirkungen motorisch- koordinativer Defizite im Kindesalter erstrecken sich bis in das Erwachsenenalter hinein und führen neben der Beeinträchtigung der Persönlichkeitsentwicklung zu volkswirtschaftlichen Verlusten, die bislang nicht bezifferbar sind.
Zu den psychosozialen Hauptrisikofaktoren für eine gesunde kindliche Entwicklung gehören u.a. chronische Disharmonie und Desorganisation in der Familie, niedriger sozioökonomischer Status, mangelnde psychosoziale Kompetenz, Gewalt, sexueller Missbrauch, große Familien in sehr engem Wohnraum, Isolation der
(alleinerziehenden) Mutter, Kriminalität eines Elternteils, psychische Störungen der Eltern.
Die psychosomatische Prävention involviert aber auch die Förderung von Schutzfaktoren:
eine gute Beziehung zu einer Bezugsperson, die Anwesenheit weiterer entlastender Personen im Haushalt (Großeltern, Geschwister) und außerfamiliäre Ressourcen, gute Freunde, Beeinflussungsmöglichkeiten anderer durch kommunikative Fähigkeiten, begründen ein positives Selbstbild.
Diese Schutzfaktoren können so interpretiert werden, dass sie den Kindern Vertrauen hinsichtlich ihres Lebenszusammenhanges vermitteln: Sie können sowohl auf eigene Einflussmöglichkeiten als auch auf Unterstützung bauen und können sich von negativen Einflüssen distanzieren (zu Risiko- und Schutzfaktoren s. auch Petzold/Goffin/Oudhof 1993, Nuber 1995, Bender/Lösel1997).
Risiko- und Schutzfaktoren kann man als Faktoren sehen, die Ereignisse und Erfahrungen über längere Zeiträume beeinflussen, es entstehen "Ketten" von Erfahrungen positiver oder negativer Art.
Im gelungenen Fall stellt die psychosomatische Prävention den Beginn einer Kette positiver Erfahrungen dar, einen Kristallisationskern für die Einbettung von weiteren Schutzfaktoren in die Familie und eine gemeinschaftliche Initiative zur Gesunderhaltung aller Familienmitglieder.
Hierin liegt das Ziel: den Grundstein zu legen für das tägliche Bewusstsein einer immer wieder neu zu schaffenden Gesundheit, für die es sich lohnt eigene Anstrengungen zu unternehmen.
Eine erfolgreiche Implementierung der psychosomatischen Prävention in ein modernes Gesundheitswesen ist allerdings mit der Beantwortung der Frage verbunden, auf welchem Weg und mit welcher Motivation diese Familien in die Beratung kommen. Hier sollten unserer Meinung nach viele Wege geöffnet und gebahnt werden aus unterschiedlichen Richtungen, sei es über den überweisenden Hausarzt oder Kinderarzt, über Empfehlungen der Krankenkassen, Einrichtungen im Gesundheitswesen, Amtsärzte, Kliniken u.a. Ein gesamtgesellschaftliches Problem kann nur gemeinschaftlich und integrativ gelöst werden.
Hierzu könnte die psychosomatische Prävention einen wichtigen Baustein liefern.
Die amerikanische Psychobiologieprofessorin Shirley Y. Hill formulierte unlängst in Bezug auf die Risikogruppe der Kinder aus Suchtfamilien die Forderung nach radikaler Aufklärung mit den Worten "You have to know your risks". Diese Forderung sollte aber wesentlich erweitert und in einen gesamtgesellschaftlichen Kontext gestellt werden.
Dr. Norbert Panitz
Berlin, den 17. April 2007